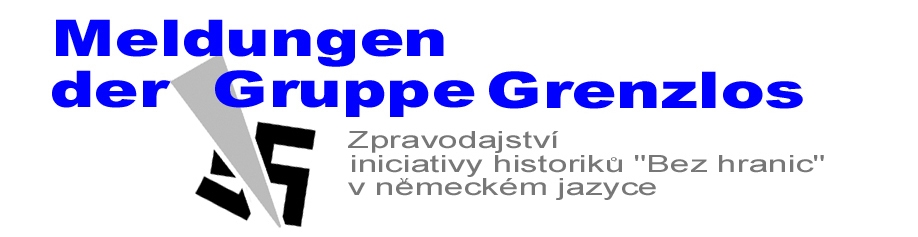
Sebnitz (DE) & Dolní Poustevna (CZ)
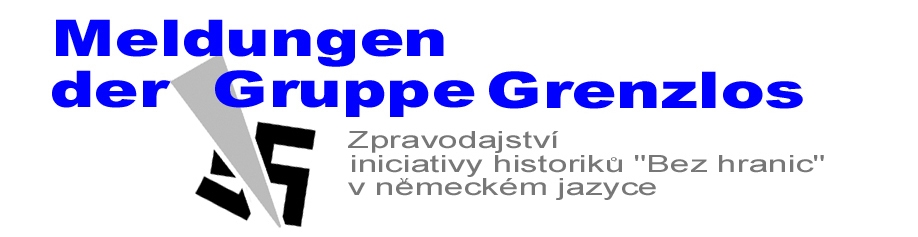
Sebnitz (DE) & Dolní Poustevna (CZ) ![]() Seit April 2005
Seit April 2005 ![]() Zuletzt aktualisiert am 30. April 2019
Zuletzt aktualisiert am 30. April 2019 ![]() Kontakt
zur Redaktion
Kontakt
zur Redaktion
|
|
vorwärts zu den aktuellen Nachrichten |
| Mai
2013
|
|
|
|
In seinem
Kriegstagebuch aus dem ersten Weltkrieg erwähnt der damals nur wenig
bekannte Journalist Egon Erwin Kisch ("Schreib das auf, Kisch")
den Tod seines Kriegskameraden Rudolf Rößler. Der Freund war im ersten
Kriegsjahr 1914 in Bosnien an der Drina gefallen. Korporal Kisch war als
k.u.k. Reservist eingezogen worden und fünf Jahre älter als Rößler; ihm wird
die Aufgabe zuteil, Rößlers Eltern vom Tod ihres einzigen Sohnes in
Kenntnis zu setzen. Dieses und viele andere Erlebnisse an der Front haben
aus Kisch einen entschiedenen Kriegsgegner gemacht. René Senenko hat sich
in Rößlers Heimatstadt Dolní Poustevna (Niedereinsiedel) ein wenig nach
Spuren des Fabrikantensohns umgesehen und das Resultat seiner Recherche in
der neuen Ausgabe der "Děčínské
vlastivĕdné
zprávy" (Děčíner
heimatkundliche
Berichte) veröffentlicht. Hier die für Grenzlos.info erstellte deutschsprachige
Fassung. |
| März
2013
|
|
| Die in Prag
erscheinende "Landeszeitung der Deutschen in der Tschechischen
Republik" ist ein Zweiwochenblatt, in dem wir viel über das Kulturleben
in Tschechien erfahren, sofern es in irgendeiner Weise Belange der
deutschen Minderheit in der
ČSR berührt. Politisch fährt es im Fahrwasser
der "Vertriebenen-Vertretung" der CSU (also
"Versöhnung" à la Bernd Posselt), auch wenn das Blatt diese
Anbindung nie offen erwähnt. Das sonst in einer Sprache von Toleranz
gepflegte Blatt wird dann schrill, wenn es gegen links geht. Dann
attackiert es Putin und Präsident Zeman, und wenn das Thema auf die
tschechischen Kommunisten kommt, dann vergessen die Herren Schmidt und
Palata ihre sonst so moderate Schreibe. In jeder
Ausgabe versucht das Blatt, dem Leser beizubiegen, dass auch die Tschechen Dreck am Stecken
haben, und das nicht zu knapp. Artikel über verödete Dörfer in den
ehemaligen Sudeten und über Vergeltungsaktionen nach der Befreiung 1945
an Deutschen, über heutige Versöhnungsgesten von Deutschen und Tschechen usw.
gehören zu den Lieblingsthemen. Das Motto dieser Zeitung könnte lauten:
Wenn wir schon gemeinsam unser Europa gestalten, dann bitte historisch auf
Augenhöhe, dann müssen auch die Tschechen endlich ihre Verbrechen
eingestehen. - Umso mehr musste verwundern, dass sich in die Ausgabe vom
26. März ein ganzseitiges Interview mit der Historikerin Alená
Wagnerová verirrt hatte, deren Feststellungen den sonst im Blatt zu
findenden Prämissen ganz zuwiderlaufen. Wir hingegen können Alená
Wagnerovás Einsichten nur unterstützen. Lesen Sie selbst. Artikel. |
|
| Jan.
2013
|
|
|
|
Wer sich in der
Geschichte des von uns erforschten Todesmarschs auskennt, wird sich
erinnern, dass unter den Häftlingen aus vielen Ländern auch Kommunisten
waren. Der 1902 in Königsbrück bei Dresden geborene Ofenformer Paul
Bergmann war einer von ihnen. Wer war dieser Mann? Paul Bergmann blieb als
junger Mann auf der Walz in Kiel hängen, trat dort der Gewerkschaft und
der SPD bei und wurde einer der aktivsten Arbeitersportler Kiels. Seit
1922 Mitglied der KPD gründete er den RFB (Rotfrontkämpferbund) mit.
Wegen illegaler Sprengstoffbeschaffung wurde er (ebenso wie weitere 9
Kommunisten) in Bautzen zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er in
Waldheim in vollem Umfang absitzen musste. Nach Verbüßung dieser Strafe
kam er 1939 sofort ins KZ Oranienburg, später nach Sachsenhausen. In
Sachsenhausen gehörte er der illegalen Widerstandsgruppe um Ernst
Schneller an. Als Bergmann 1944 nach Schwarzheide kam, übertrug ihm seine
Partei den Auftrag, "so viele Häftlinge wie möglich aus dem Lager
Schwarzheide lebend herauszuringen". Bei den 1000 tschechischen
Juden, die in Schwarzheide ankamen, handelte es sich vorwiegend um sehr
junge Leute. Der 42jährige Bergmann wurde für viele von ihnen ein
Mithäftling, der Dank seiner Erfahrung half, wo er konnte. Sie kannten
seinen Namen nicht, doch der Tscheche Miroslav Konecný wusste diese Hilfe
zwei Jahre nach dem Krieg zu würdigen: "Ich gedenke Ihrer stets mit
Dankbarkeit... und ohne Sie hätte ich das Ganze nicht überstanden."
Nach dem Krieg stellte sich Paul Bergmann in Königsbrück dem
Wiederaufbau zur Verfügung. Das Bild links zeigt ihn (Bildmitte) um 1970
als Angehöriger der Kampfgruppen seines Betriebes (VEB Wärmegerätewerk
Königsbrück). 1979 starb Paul Bergmann in seiner Heimatstadt, zu früh,
als dass ihn die Schüler der AG "Junge Historiker" noch hätten
interviewen können. Dr. Dieter Rostowski (Kamenz) hat im eben
erschienenen "Lausitzer Almanach" (Nr. 8) ein Lebensbild von
Paul Bergmann gezeichnet, der - wie wir in dem Beitrag erfahren -
zeitlebens ein äußerst bescheidener Mensch geblieben ist. Der Almanach
(192 S. ill.) umfasst Beiträge zu vielen Aspekten der Heimatgeschichte
der Lausitz. Bestellbar ist das Heft unter info@lausitzer-almanach.de
zum Preis von 9,50 Euro + 1,50 Porto. |
vorwärts zu den aktuellen Nachrichten
2011 keine Nachrichten
Nachrichten
2010
Nachrichten 2009
Nachrichten 2008
Nachrichten 2007
Kontakt
zur Redaktion
Verwandte Themen und
befreundete Organisationen
©
2005-2013 by René Senenko, P.O. Box
3460, D-22827 Norderstedt, Germany. Gruppe Grenzlos / Iniciative
historiků "Bez hranic" in Sebnitz / Dolní Poustevna